Als Stricken noch kein Hobby war
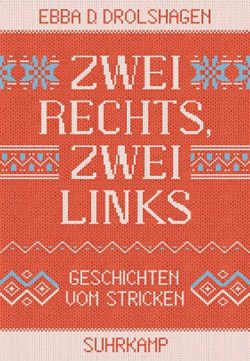
Die Kunst, die vermutlich aus dem Mittleren Osten nach Europa kam, war jahrhundertelang Broterwerb und Überlebenstechnik, im Deutschland des 15. Jahrhunderts sogar ein Zunftberuf, der Männern vorbehalten war. Erst viel später hielten Nadeln und Wolle Einzug in die Damensalons des Bürgertums. Drolshagen erzählt, unterhaltsam und detailreich, auch von unterschiedlichen Stricktechniken, vom Wandel von der Heimarbeit zum internetgetriebenen Modethema, von Norwegermustern und strickenden Feministinnen.
Ein Mädchen, das nicht stricken konnte, sei kein Mädchen, hieß es lange. Ein erschütterndes Foto aus dem Kriegsjahr 1939 zeigt, was das bedeutete: Die kleine Shetländerin Chrissie, nicht älter als drei oder vier, sitzt auf einem Kinderstühlchen und streichelt mit der einen Hand eine Katze. Die andere hält ein weit fortgeschrittenes Strickzeug. »Knitting for Britain« hieß die Kampagne, die das Stricken für Soldaten zur kriegswichtigen Angelegenheit machte. Und little Chrissie musste mittun.
Nach 251 Seiten und vielen Geschichten und Anekdoten rund ums Stricken hat man unendlich viel dazugelernt – und möchte von der Theorie zur Praxis wechseln. Zwei rechts, zwei links…
»Zwei rechts, zwei links«, Ebba D. Drolshagen, Suhrkamp Verlag, Berlin 2019, 18 Euro
Zwölf »Blagen« aus dem Ruhrpott

Um im Bild zu bleiben: Aus den Flözen der eigenen Großfamilie lässt sich viel Verborgenes ans Tageslicht befördern, wenn man nur ausdauernd gräbt. Frank Zimmermann, der Ich-Erzähler aus dem Kohlerevier, entwickelt diese Ausdauer und macht sich, weil selbst als Vater gescheitert, im Untergrund auf die Suche. Tatort dieses wunderbar lakonisch erzählten Milieu-Romans ist der Ort Beifang im nördlichen Ruhrgebiet, wo auch Autor Martin Simons aufgewachsen ist.
Welchen Beifang, welche ungewollt im Netz hängen gebliebenen Traumata sein Protagonist mit sich herumschleppt, entrollt der Roman Schritt für Schritt. Während der Vater wie immer schweigt, berichten zahlreiche Onkel und Tanten Widersprüchliches, ja Groteskes. Der tote Großvater, der mitten in der Wirtschaftswunderzeit mit Frau und zwölf »Blagen« auf 60 Quadratmetern lebte, vom Krieg traumatisiert und in unerträglicher Armut, wird zur Schlüsselfigur. War er bei der SS? Wurde er wirklich von einem Sohn um die Ecke gebracht? Die berüchtigte Zimmermann-Sippe, die einiges auf dem Kerbholz hat, aber keine Worte für ihr Innenleben, trägt schwer an der Brutalität und Lieblosigkeit, die sie daheim in Beifang erlebt hat. Und der nachfragende Familienforscher erfährt ganz nebenbei, dass er nur deshalb nicht abgetrieben wurde, weil seine jugendlichen Eltern damals den Termin versäumt hatten. »War wirklich knapp«, sagt ein Onkel.
Beifang ist ein wahrhaftes, grundehrliches und unbedingt spannendes Buch, das Ruhrpott-Sippen wie den Zimmermanns ein großes Denkmal setzt.
»Beifang«, Martin Simons, Aufbau Verlag, Berlin 2022, 22 Euro
Bis zum letzten Atemzug
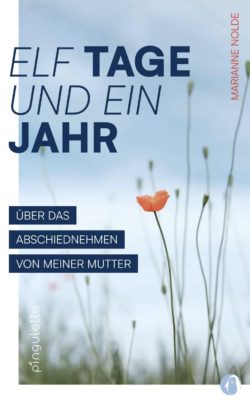
Autorin Marianne Nolde hat die letzten elf Tage am Sterbebett ihrer Mutter aufmerksam, manchmal humorvoll und immer voller Empathie protokolliert. Vom erleichternden Gespräch über die bevorstehende Beerdigung über die letzten Begegnungen mit Enkeln und Freunden bis hin zum Staunen darüber, dass die nicht immer unkomplizierte Beziehung zur Mutter am Ende so warm und versöhnlich wird.
Dieses Sterben, schreibt sie, sei ein Geschenk für alle gewesen. Aber auch eine Erfahrung, die nach einigen Tagen so an den Kräften der Tochter zehrt, dass sie sich zurücknehmen muss, um wieder aufzutanken. Dann sitzen andere bei »Oma«, die immer stiller wird.
Eine zugewandte Palliativ-Beraterin, die aufräumt mit dem Irrglauben, dass Sterbende unbedingt trinken müssen, ein Pflegeheim, das vorbildlich auf die Bedürfnisse der 91-Jährigen eingeht, kein Hadern, kein Kampf – auch wenn die Umstände des Abschiednehmens nicht immer so ideal sind wie hier, machen Marianne Noldes Eindrücke und Gedanken doch Mut, das Sterben als Teil des Lebens zu sehen. Das gilt auch für Menschen, die nicht so religiös sind wie Mutter und Tochter, die kein Holzkreuz auf der Brust umfassen und nicht beten wollen auf ihrer letzten Reise.
Das Buch endet nicht mit Josefines letztem Atemzug, sondern beschreibt ausführlich, was danach kommt. Der Sarg, der Pastor, später der Grabstein und der letzte Besuch im Altenheim, es dauert nicht elf Tage, sondern ein Jahr, bis die Trauer ihren Rahmen gefunden hat.
»Elf Tage und ein Jahr»«, Marianne Nolde, Pinguletta Verlag, Keltern 2022, 17 Euro
Wie der Blas auftauchender Wale
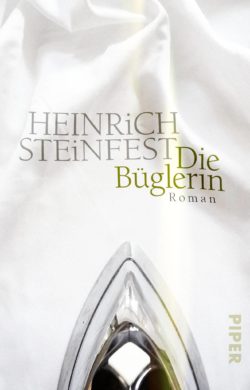
Zugegeben, an Heinrich Steinfests bildlastige Sprache muss man sich gewöhnen wie an ein knisternd steifes, soeben gebügeltes Hemd – so ähnlich würde er das vermutlich ausdrücken. Schnell aber kennt man sich aus und folgt seinen Wortarabesken immer müheloser. Warum auch sollte eine Stimme nicht etwas von Olivenöl haben, »wenn man sich vorstellt, Olivenöl könnte sprechen. Mit der schönsten Stimme aller Pflanzenöle«. Das ölige Organ gehört übrigens dem Mann, mit dem die Büglerin eine zögerliche Beziehung eingeht und mit dem sie ihre Leidenschaft fürs Schwimmen teilt. Er ist der Mann, der auch am Ende bei ihr ist. Mehr soll nicht verraten werden.
Es verwundert nicht, dass der gebürtige Österreicher Heinrich Steinfest auch Autor zahlreicher Krimis ist. Die streckenweise mysteriös-spannende Handlung hat viel von diesem Genre, auch wenn hier kein Kommissar sein Unwesen treibt. Weil´s gar so schön ist, noch ein kleiner Auszug aus Tonia Schreibers Bügel-Ritual. »Bei all dem setzte sie den Dampf mittels kleiner, kurzer Stöße ein. Ein Klang wie der Blas auftauchender Wale.« Viel zu gut, um eine Strafe zu sein.
»Die Büglerin«, Heinrich Steinfest, Piper Verlag, München 2018, 20,60 Euro
Buchempfehlungen: Claudine Stauber
Ein starkes Stück Stadtgeschichte
In Deutschland wird kaum eine Einrichtung so stark mit dem Begriff Soziokultur verbunden wie das Komm an der Nürnberger Königstraße. Von 1973 bis 1997 wurden hier basisdemokratisch und selbstverwaltet Kulturveranstaltungen organisiert. Unumstritten war das Komm in den 23 Jahren seines Bestehens allerdings nie, manchmal trafen Staatsmacht und die Anhänger des Komm aufeinander.
Michael Popp hat das Komm mit initiiert und über viele Jahre mitgestaltet. Er hat – in Zusammenarbeit mit anderen Autoren – die Geschichte des Kultur- und Kommunikationszentrums aufgeschrieben und ein Buch daraus gestaltet. Er konnte zu Lebzeiten das Werk nicht vollenden, der Kunstpädagoge und Kulturdirektor starb am 27. November 2017. Sein Sohn Christof hat sich der halbfertigen Arbeit angenommen und das 380 Seiten starke Buch nun herausgegeben.
»Komm – 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung«, Verlag vieler orten, Nürnberg 2022, 36 Euro.
















