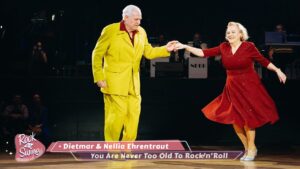Bisher sind Wissenschaftler weltweit davon ausgegangen, dass das Immunsystem von Patienten, die einen schweren Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus hatten, schwächer auf die Infektion reagierte. Es ist aber genau umgekehrt, wie ein Team um Professorin Martina Sester vom Universitätsklinikum des Saarlandes nun herausgefunden hat. Ein schwerer Verlauf ist laut jetzt erschienener Pressemitteilung ein Indiz für eine starke Immunantwort.
Am Anfang war das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 eine große Unbekannte. Wenig bis nichts war bekannt über seine krankheitsbestimmenden Mechanismen. Mit der Zeit – und durch die Dringlichkeit, ein Medikament oder Impfstoff zu finden und bessere Therapiemöglichkeiten zu entwickeln – finden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun aber mehr über das Virus und seine Folgen heraus. So setzen sie Puzzleteil um Puzzleteil zusammen, um das Virus besser verstehen zu können.
T-Zellen im Fokus
Eines dieser Puzzleteile hat nun Martina Sester, Professorin für Transplantations- und Infektionsimmunologie, gemeinsam mit weiteren Kolleginnen und Kollegen aus der Infektionsmedizin, der Inneren Medizin und der Hämostaseologie des Universitätsklinikums des Saarlandes entdeckt. In ihrer Studie haben sie ihr Augenmerk speziell auf die sogenannten T-Zellen gerichtet, die als Blutzellen ein Teil der Immunantwort des Menschen sind. Die T-Zellen sind in der weltweit auf Hochtouren laufenden Forschung zum Coronavirus bisher seltener in den Mittelpunkt gestellt worden, ganz im Gegenteil zu den Antikörper-Studien, die derzeit vielfach entstehen.
Überraschende Erkenntnisse
„Dabei spielen auch die T-Zellen eine wichtige Rolle. Denn T-Zellen sind genau wie Antikörper ein Teil der spezifischen Immunantwort des Körpers, die speziell auf einen bestimmten Erreger zugeschnitten wird“, erläutert Martina Sester. Erkenntnisse über die T-Zellen lassen also unmittelbare Rückschlüsse auf die Kontrolle des Virus selbst zu. „In unserer Studie haben wir nun erstmals schwere Krankheitsverläufe mit milden Krankheitsverläufen verglichen“, so Sester. „Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Patienten mit schweren Krankheitsverläufen das schlechtere Immunsystem aufweisen und diejenigen mit milden Symptomen das bessere. Es ist aber genau umgekehrt“, fasst die Immunologin die überraschenden Erkenntnisse der Studie zusammen.
Von den 50 Patienten, deren Daten in die Studie eingeflossen sind, hatten 14 Patienten schwere Verläufe; die im Mittel 64 Jahre alten Männer und Frauen wurden auf der Intensivstation des Uniklinikums behandelt. 36 Patienten (mittleres Alter 42 Jahre) zeigten nach positivem Test keine oder nur sehr milde Symptome wie Husten, Schleimhautentzündungen, Muskelschmerzen oder zeitweisen Verlust des Geruchssinns.
Organschäden sind die Folge
„Es hat sich nun gezeigt, dass mit zunehmender Schwere der Erkrankung auch die Zahl der gegen das Virus gerichteten T-Zellen stark angestiegen ist, und der Anstieg dieser Zellen mit der Zahl der spezifischen Antikörper gegen Sars-CoV-2 korreliert“, fasst Sester eine zentrale Erkenntnis zusammen. Das bedeutet, dass ein Patient mit schwerem Verlauf, entgegen der bisherigen Annahme, grundsätzlich sehr gut auf die Infektion reagiert, da sein Immunsystem sehr viel stärker auf das eindringende Virus reagiert und auch die Zahl der Antikörper entsprechend in die Höhe schnellt. „Allerdings hat das Immunsystem dann große Schwierigkeiten, die überschießende Immunantwort wieder zu drosseln, wenn die Viruslast sinkt und die Replikation der Viren zum Beispiel im Lungengewebe gestoppt werden konnte.“ Wie in einer Art Autoimmunreaktion richten sich die T-Zellen und die Antikörper, denen das Virus als Feind abhandengekommen ist, dann gegen das körpereigene Gewebe, was zu Organschäden führen kann.
Stärkere Immunität nach schwererem Verlauf?
Die Ergebnisse der Studie werfen auch eine weitere Frage auf: Sind Patientinnen und Patienten tatsächlich nachhaltig immun gegen das Virus, wenn sie eine Krankheit überstanden haben? „Eine These könnte lauten, dass Patienten mit schwererem Verlauf möglicherweise durch die stärkere Immunität auch länger geschützt sind als Patienten mit milderen Verläufen“, schlussfolgert Sester. Dazu führen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen weitere Verlaufsmessungen durch. Auch die Aussagekraft sogenannter Antikörpertests, mit denen man herausfinden möchte, wie groß der Teil der Bevölkerung ist, die bereits eine Krankheit überstanden haben, ohne es vielleicht bemerkt zu haben, müsste nochmal hinterfragt werden. Denn bei Personen mit milden Verläufen könnte die Zahl der Antikörper dann rasch unter die Nachweisbarkeitsschwelle fallen.
Originalpublikation: www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.08.20148718v1.full.pdf