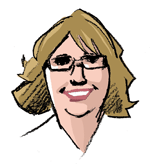
Ich bin angesichts der Nachrichtenlage nicht im Stande, diese Frage zu beantworten. Aber die steigende Gebärfreudigkeit der Frauen mit hoher formaler Bildung hat bei mich einen kurzen Moment innehalten lassen. Ich stellte mir vor, wie es in 20 Jahren aussehen könnte, wenn der prognostizierte Fachkräftemangel nicht eintritt, weil genügend Nachwuchs in die Arbeitswelt drängt. Welche Jobs würden sie vorfinden?
Könnte es sein, dass die Alten dann doch nicht bis 80 arbeiten müssen, wie es Herr Müntefering uns gerne vorschreiben würde? Wäre es nicht eine Chance, das Renteneintrittsalter flexibler zu gestalten, den Vorruhestand wieder einzuführen, um den Jungen Platz zu machen? Vielleicht gäbe es dann auch ein Ende der Debatte, wieviel Prozent des früheren Einkommens man den Rentnern noch lassen darf, bevor das System kollabiert?
Mir macht die Perspektive, dass es in zehn oder zwanzig Jahren wieder mehr Kinder geben wird, Mut. Denn es ist keine schöne Vorstellung, dass ich einer Generation angehöre, der man Langlebigkeit zum Vorwurf macht und somit diese Errungenschaft mit einem negativen Vorzeichen versieht. Aus diesem Dilemma können wir uns nicht selber befreien, das müssen die nachfolgenden Generationen übernehmen. Schön, wenn sie sich gerade in größerer Zahl auf den Weg machen.














