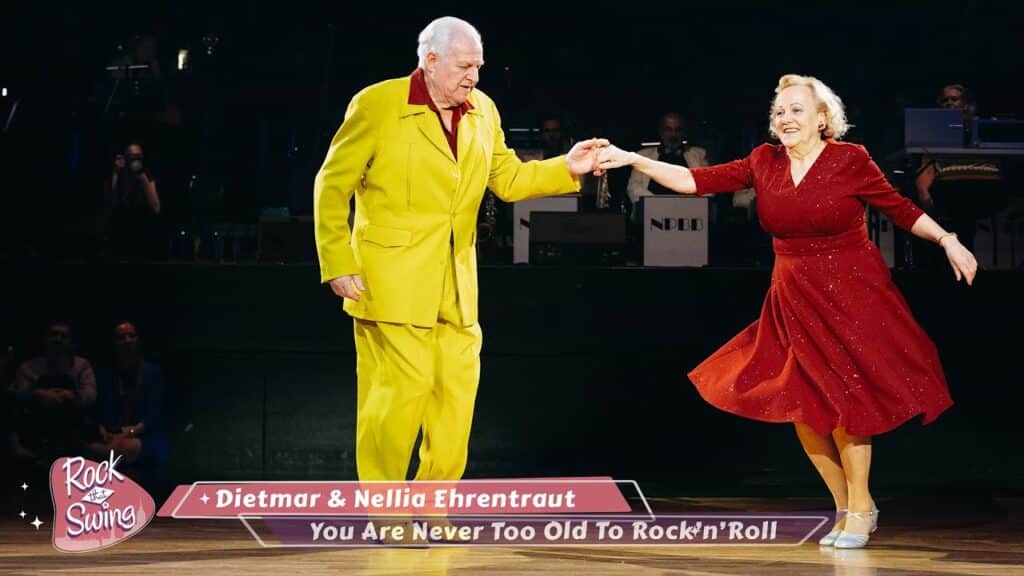Nach einer langen, erfolgreichen Karriere und zuletzt 15 Jahren als Sozialreferent der Stadt Nürnberg begann für Reiner Prölß Anfang Mai der Ruhestand. In seiner Amtszeit hat er viel bewegt. Was sich speziell für die Älteren verändert hat, welche Aufgaben auf Prölß Nachfolgerin Elisabeth Riess warten und wie er selbst den nächsten Lebensabschnitt gestalten möchte, darüber sprachen wir mit dem 66-Jährigen.
Sie waren für Kinder, Jugend, Familien und Senioren zuständig. Hat sich in den zurückliegenden 15 Jahren die Gewichtung zwischen den einzelnen Gruppen verändert?
Die Gewichtung vielleicht nicht, aber die Bedeutung hat sich verändert. Die Kinder standen lange im Zentrum, die Jugendlichen wurden häufig als Problemfall gesehen. Bei den Familien steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Mittelpunkt, und im Seniorenbereich hat sich das Bild vom Menschen im Alter gewandelt. In der Pflege ging man viele Jahre davon aus, dass der Markt und Wettbewerb für ein bedarfsgerechtes Angebot sorgt mit der Folge der Privatisierung vieler kommunaler Einrichtungen, ähnlich bei den Krankenhäusern. Eine falsche Weichenstellung, die man langsam erkennt. Wir dürfen die Pflege nicht privaten Konzernen mit teilweise sehr hohen Renditeversprechungen überlassen. Die Kommune muss wieder Einfluss auf die Daseinsvorsorge gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden bekommen.
In der Versorgung der älteren Bürgerinnen und Bürger galt lange die Maxime, ambulant vor stationär, privatwirtschaftlich vor kommunal. Sie haben sich dieser Sichtweise nicht angeschlossen. Sind Sie immer noch der Meinung, dass beides gleichberechtigt nebeneinanderstehen sollte?
Ambulant vor stationär ist eine zutiefst ideologische Frage. Sie ist vom haushaltspolitischen Denken geprägt, weil die stationäre Pflege vermeintlich teuerer ist. Dabei existieren so viele Wohnformen dazwischen wie Kurzeitpflege, Tages- oder Nachtpflege etc. Ich finde, was die Form der Pflege anbelangt, muss jeder für sich und mit seinen Angehörigen entscheiden: Was ist für mich ganz persönlich die richtige Lösung? Entscheidend ist die Frage: Wo habe ich mehr Freiheit und mehr Lebensqualität? Wir brauchen gute ambulante Pflege und gute Einrichtungen. Gerade die Pflege zu Hause ist eine häufig eine große Belastung. Unter der Genderperspektive, betrachtet, sind es ja vor allem Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter, die die häusliche Pflege stemmen müssen. Wir brauchen eine ganz andere Finanzierungslogik und Angebotsstruktur in der Pflege. Es wird richtigerweise vorgeschlagen, die Finanzierung nun vom Kopf auf die Füße stellen. Das bedeutet, die Grundversorgung sollte jeder aus der eigenen Tasche bezahlen – sofern das möglich ist. Was zusätzlich geleistet werden muss, zusätzliche Aufwände, wird durch die Pflegeversicherung abgedeckt. Also genau umgekehrt wie es jetzt gehandhabt wird.
Schauen wir mal auf den ambulanten Bereich. In den letzten Jahren wurde die Idee der Seniorennetzwerke in den Stadteilen ausgebaut. Ist es tatsächlich ein Weg, um den Menschen das Älterwerden in den eigenen vier Wänden länger zu ermöglichen?
Ich glaube, es ist einer der ganz wichtigen Punkte, dass sich Menschen vor Ort begegnen können, wo ganz konkret Kurse angeboten werden, wo es Stammtische für hochbetagte Menschen gibt. Seniorennetzwerke sind Kristallisationspunkte für das Leben im Alter. Das ist die Idee der Seniorennetzwerke. Das Projekt war eines der ganz, ganz wichtigen Dinge, die während meiner Amtszeit entstanden sind. Deshalb wollen wir die derzeitige Abdeckung von 80 Prozent noch weiter ausbauen. Auch an den Stadträndern soll es bald ähnlich strukturierte Angebote geben.
In der Coronakrise haben sich in kurzer Zeit Hilfsinitiativen gebildet. Doch die Nachfrage nach den – meist ehrenamtlichen Diensten – war eher verhalten. Warum fällt es offenbar vielen schwer, sich helfen zu lassen?
Ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich decken familiäre und nachbarschaftliche Strukturen für viele das ab, was man im täglichen Bedarf braucht. Das scheint gut zu funktionieren. Ich glaube, durchschlagender ist der zweite Grund. Die Menschen haben aus Infektionsgründen Angst, jemandem zu nahe zu kommen. Man wird das Verhalten nach der Krise näher untersuchen müssen.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Versorgungslage der Nürnberger im Rentenalter? Wo ist die Situation gut, wo gibt es Nachholbedarf?
Wir wissen durch die Seniorenumfrage, die wir vor kurzem zum Teil veröffentlicht haben, dass es dem Großteil der Älteren gesundheitlich und auch sonst relativ gut geht. Wir wissen auch, dass, statistisch betrachtet, Altersarmut noch kein so großes Problem ist, aber zunehmen wird. Ich glaube, dass man die Versorgungslage weiterentwickeln kann, indem man bestimmte Leistungen durch bestimmte Plattformen in eine Art virtuelles Seniorennetzwerk überführt. Das wird sicherlich im Lauf der nächsten Jahre kommen. Mit den Seniorennetzwerken und vielfältigen Angeboten ist Nürnberg gut aufgestellt. Über 90 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in Nürnberg wohl fühlen und gerne hier leben.
Das Bild vom älteren Menschen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Werden wir auf absehbare Zeit auch im Ruhestand unsere Kompetenzen einbringen können und anerkannt werden? Oder ändert sich gerade jetzt etwas Grundlegendes?
Es macht einen schon nachdenklich. Ich kenne viele Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren und ihre Zeit in Projekte investieren. Das war eine der wichtigen Weichenstellungen in meiner Amtszeit, dass wir den Bereich des zivilen Engagements stark ausgebaut und aufgewertet haben.
Die Digitalisierung hat vor allem in der Arbeitswelt große Veränderungen in einem kurzen Zeitraum bewirkt. Jetzt greift sie immer mehr auf das Privatleben über. Ist es eine Aufgabe der Städte und Gemeinden dafür zu sorgen, dass die Älteren dabei nicht abgehängt werden?
Die Digitalisierung ist ein epochaler Wandel in der Gesellschaft, vergleichbar mit der Entdeckung des Buchdrucks oder der Entwicklung der Schriftsprache. Der Wandel verändert uns, was das Zusammenleben und was Privatheit bedeutet. Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Es hängt davon ab, wie man sie gestaltet. Auf kommunaler Ebene versuchen wir die Entwicklung so zu steuern, dass Menschen teilhaben können. Wenn wir die Stadtverwaltung digital organisieren, muss es trotzdem Möglichkeiten geben, analog zu sein. Andererseits nutzen von den 60- bis 69-Jährigen weit über 80 Prozent regelmäßig das Internet. Das zeigt, dass die Digitalisierung die Gesellschaft schon gut durchdrungen hat.
Gerade ältere Menschen leben oft allein. Einsamkeit ist ein Wort, das im sozialen Bereich an Bedeutung gewinnt. Wie kann man der Vereinsamung entgegenwirken? Was kann eine Stadt dagegen tun?
Durch unsere Befragung wissen wir, welche Dimension das Einsamkeitsempfinden hat. Zwei Erkenntnisse sind besonders bemerkenswert. Jeder Zehnte der über 60-Jährigen fühlt sich einsam. Mit dem Alter – und wenn man zudem in seiner Mobilität eingeschränkt ist – nimmt das Gefühl zu. Wir haben gute Ansätze entwickelt und werden an dieser Stelle weiterdenken. Wir müssen den Menschen Hilfestellung geben, dass sie ihre Scham überwinden, Hilfe anzunehmen. Und wir brauchen Anreize, das sich Ältere aufraffen, sich proaktiv einzubringen. Wie man das organisiert, ist eine noch offene Frage. Es geht nicht nur um die materielle Basis. Die Armutsfrage ist die eine Seite, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe die andere.
Man spricht bei der Lebensphase zwischen 60 und 80 von geschenkten Jahren, in denen viele Menschen fitter sind als es ihre Vorgängergeneration war. Wie planen Sie, diese Zeit auszufüllen?
Ich habe noch keine konkreten Pläne, sicher werde ich nicht Däumchen drehend zu Hause sitzen. Erst einmal freue ich mich auf die Zeitsouverenität. Ein gibt ein paar Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Den Archivkeller in Ordnung zu bringen, auszumisten. Bestände durchzuschauen. Was muss man aufheben, was nicht? Reisen. Öfter ins Theater und Kino gehen. Dann freue ich mich aufs Lesen.

Sie sind ein Homo Politicus. Werden Sie sich auch künftig politisch engagieren?
Ich habe mir vorgenommen, keine guten Ratschläge zu erteilen. Ich möchte mich eher raushalten. Ob mir das ganz gelingt, weiß ich nicht.
Ihnen wurden sicher bereits einige Ehrenämter angetragen. Haben Sie sich schon für Aufgaben entschieden oder möchten Sie erst einmal Abstand gewinnen und dann entscheiden?
Große, weitere Planungen gibt es noch nicht, ich bin neugierig, wer mit welchen Ideen und Erwartungen auf mich noch zukommt.
Sie reisen gerne. In welche Länder möchten Sie als nächstes fahren, wenn es wieder möglich ist?
Westliches Südafrika, Kalahari. Ganz oben auf der Agenda stehen die Ostküste der USA, und damit der Indian Summer, Nordwest Kanada, Seattle, Island und das innere Spanien sowie die Baltischen Staaten.
Was werden Sie nach Ihrem Abschied aus dem Amt am meisten vermissen, was am wenigsten?
Am meisten werde ich die vielen sympathischen und engagierten Kollegen und Kolleginnen vermissen. Und die politische Freude, Dinge ganz aktiv gestalten zu können. Froh bin ich, dass ich manches, was an unfreundlichen Äußerungen und Anfeindungen auf einen einstürmt, nicht mehr abarbeiten muss. Ich kann künftig eher klipp und klar sagen, was ich von manchem Vorgehen halte, ohne Rücksicht auf mein Amt nehmen zu müssen.
Fragen: Petra Nossek-Bock
Fotos: Anestis Aslanidis, Michael Matejka / NN-Archiv